Eltern von Kindern, die eine ARFID-Diagnose haben, stellen sich oft die Frage. wie entsteht ARFID? und bin ich schuld daran, dass mein Kind ARFID hat? ARFID kann viele Ursachen haben und die Forschung steht hier noch ganz am Anfang, aber einige Punkte wissen wir jetzt schon.
Was ist ARFID?
ARFID ist eine vergleichsweise neue Diagnose. Mittlerweile ist sie auch im Diagnosesystem der WHO ICD-11 aufgeführt. Jedoch ist die Erkrankung in dem Sinne nicht neu, sondern wurde schon sehr früh in der Literatur beschrieben. Davor wurden Kinder mit einer solchen Symptomatik in die allgemeinere Diagnosekategorie einer „Fütterstörung“ einsortiert, nun gibt es mit der „ARFID“-Diagnose präzisere Kriterien. Von ARFID spricht man gemäß WHO, wenn:
- sehr selektiv gegessen wird
- wenig Interesse an Essen besteht, insbesondere an neuen Sachen
- Lebensmittel aufgrund ihrer Eigenschaften abgelehnt werden
- oft auch Gewicht und Wachstum reduziert sind, wenn es schon länger besteht
- das Kind angewiesen ist auf besondere Kost, man also anders kochen oder zubereiten muss damit das Kind überhaupt etwas isst oder sogar Nahrungsergänzung notwendig ist
- eine hohe Empfindlichkeit gegen bestimmte Gerüche, Geschmäcker, Texturen usw. besteht
- im Unterschied zu anderen Essstörungen keine Sorge um Körpergewicht und Figur beim Kind selbst besteht
Dabei zeigen nicht alle Kinder, alle diese Aspekte gleichzeitig. Das Picky-Eating beginnt meistens in der frühen Kindheit, einschließlich Säuglingsalter und kann unbehandelt bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben, wenn tatsächlich eine ARFID vorliegt. Eine ARFID-Diagnose wird nach genauer Prüfung und Untersuchung gestellt und kann nicht allein auf Basis dieser Kriterien gestellt oder ausgeschlossen werden. Es sollten immer auch standardisierte Testverfahren zum Einsatz kommen.
Ursachen für AFRID
Natürlich wollen Eltern gerne wissen, warum gerade ihr Kind dieses Essverhalten zeigt. An den Ursachen wird noch geforscht, weshalb an dieser Stelle noch keine eindeutig wissenschaftlich belegten Ursachen genannt werden können. Es deutet viel daraufhin, dass es nicht eine einzelne Ursache gibt, sondern, dass mehrere Auslöser zu ARFID führen können.
1. Körperliche Ursachen
So können körperliche Ursachen wie z.B. Probleme beim Schlucken, mit dem Verdauungstrakt oder Unverträglichkeiten vorliegen, die dem Kind das Essen erschweren oder sogar verleiden. Deshalb ist eine Abklärung beim Kinderarzt bei anhaltenden Schwierigkeiten beim Essen oder konkreten Hinweisen auf körperliche Ursachen immer sinnvoll (häufiges Verschlucken, Bauchschmerzen nach dem Essen usw.).
2. Negative Erlebnisse
Auch negative Erlebnisse mit Essen wie z.B. heftiges Verschlucken, starkes und wiederholtes Erbrechen (z.B. durch Infekte) können dazu führen, dass ein Kind seine Nahrungsaufnahme stark und anhaltend einschränkt, aufgrund der daraus entstandenen Ängste.
3. Autismus-Spektrum
Auch bei Kindern aus dem Autismus-Spektrum kommt ARFID gehäuft vor (Quelle). Allerdings gehört zu einem Autismus noch sehr viel mehr als auffälliges Essverhalten.
4. Ungünstige Darmflora
Neuere Forschung deutet daraufhin, dass bei Kindern mit ARFID eine ungünstige Darmflora (4) häufiger zu beobachten ist (Quelle). Allerdings kann aktuell noch nicht sicher beurteilt werden, ob dies eine Folge des eingeschränkten Essverhaltens oder die Ursache dafür ist.
5. Wahrnehmungsbesonderheiten
Viele Kinder mit ARFID zeigen Wahrnehmungsbesonderheiten. So scheint bei einigen von ihnen die Sensorik des Essens eine große Rolle zu spielen. Dabei scheint es für manche nicht nur wichtig zu sein, wie etwas schmeckt oder riecht, sondern auch die Temperatur und wie es sich auf der Zunge anfühlt (weiche/harte Konsistenz).
6. Genetische Besonderheiten
Es gibt auch nachweislich bestimmte genetische Besonderheiten, die dazu führen, dass ihre Träger einen besonders sensiblen Geschmackssinn aufweisen (s.g. „Supertaster“). Sie schmecken bittere, süße und fettige Aromen deutlich stärker als Menschen, die nicht diese Genvariante aufweisen (Quelle).
7. Elterliches Verhalten
Zuletzt wirkt sich auch das elterliche Verhalten beim Essen auf das Kind aus. Wenn ihre Kinder beim Essen schon sehr früh wählerisch sind, machen sich Eltern oft Sorgen, dass sie nicht genügend Nahrung zu sich nehmen und bemühen sich dann besonders stark ihr Kind zum Essen zu bewegen. „Aber es muss doch etwas essen!“ denken sich viele Eltern dann und geraten unter Druck. Das ist sehr verständlich. Starker Druck kann jedoch die Situation unbeabsichtigt verfestigen. Deshalb sollte der von den Eltern erlebte Druck nicht an das Kind weitergegeben werden.
Ebenso führt aber das Fehlen von Angeboten an neuen Lebensmitteln dazu, dass das Kind nur bei gewohnten, „sicheren“ Lebensmitteln bleibt und nicht lernt sich auf Neues einzulassen. Wenn also gar keine Angebote von neuem Essen gemacht werden, kann dies ebenfalls zu einer Verfestigung von selektivem Essverhalten führen.
Gerade in Phasen, in denen das Kind starke Autonomiebestrebungen zeigt, kann es für Eltern herausfordernd sein, die richtige Balance aus Ermutigung und Sensibilität zu finden. Diese Balance ist allerdings in beiden Fällen – also dem vorübergehenden Picky Eating und einer ARFID-Symptomatik – das Ziel für den Umgang mit dem Essverhalten. Eine entspannte und harmonische Atmosphäre beim Essen ist die Basis für einen guten Umgang mit Picky-Eating. Das heißt auch, dass stressige Diskussionen, was nun gegessen wird und warum, nicht dazu beitragen die Situation zu verbessern. Ermutigung und Einfühlungsvermögen statt Druck oder Resignation sollten demnach ein Grundprinzip sein. Das hat sich in unserer langjährigen Arbeit an der Universitätsklinik immer wieder gezeigt.
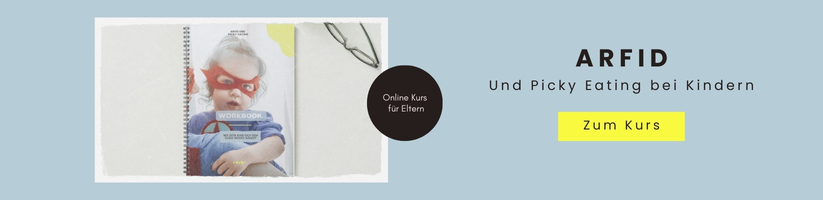
Wird das immer so bleiben?
Schwierigkeiten beim Essen können Eltern sehr belasten und sie wünschen sich daher, dass sich das Essverhalten ihres Kindes schnellstmöglich verbessert. Viele Eltern fragen sich, ob sich nun immer so bleibt. XX % lassen die Phase des Picky Eating wieder hinter sich. Bei einem kleinen Teil (XX%) verfestigt sich das wählerische Essen zu einer ARFID-Diagnose. Diese muss dann professionell behandelt werden. Je nachdem was die Auslöser sind, wird eine Psychotherapie, Ergotherapie oder Logopädie empfohlen. Bei nachgewiesenen Unverträglichkeiten wird ein entsprechender Ernährungsplan ohne die problematischen Lebensmittel (z.B. Gluten oder Lactose) umgesetzt. Oft ist auch eine multiprofessionelle Behandlung mit mehreren dieser Behandlungsansätze sinnvoll – gerade wenn mehrere Ursachen zusammenkommen.
Wo bekommst dein Kind Hilfe?
ARFID kann viele Ursachen haben und sollte immer kinderärztlich abgeklärt werden. Sobald dein Kind eine ARFID-Diagnose hat, sollte diese dringend therapeutisch behandelt werden. Hierzu kannst du dich an einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutsiche Praxis in deiner Nähe wenden. Weitere Anlaufstellen sind Sozialpädiatrische Zentren oder Ambulanzen in Kinder- und Jugendpsychiatrien. Nicht alle Anlaufstellen bieten alle Diagnostiken oder Behandlungen an, daher am besten gleich nachfragen, wenn ihr einen Termin ausmacht.
Über die Homepage der Bundestherapeutenkammer kannst du dein Bundesland und deinen Wohnort eingeben und bekommst die PsychotherapeutInnen in der Nähe deines Wohnortes angezeigt.

